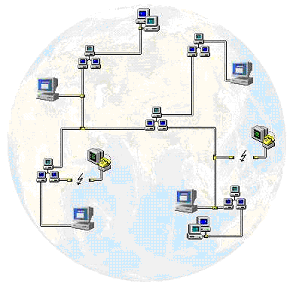|  |
|
| Internet-Dienste | Technische Standards | HTML | Suchstrategien | Internet-Glossar |
||
|
Das World Wide Web ist eine riesige, stetig anwachsende Ansammlung von Dokumenten. Es setzt sich aus Texten, Bildern, Grafiken, Videos und Sounds zusammen, die darauf warten, von "Surfern" abgerufen zu werden. Hier können Sie sich ein Bild vom Internet machen. |
||
Die Dienste des Internets |
||
| Die Bezeichnung »Internet« ist eigentlich nur
der Überbegriff für die Gesamtheit des weltweiten Netzwerkes,
d.h. die angeschlossenen Rechner, die Datenleitungen und auch die Dienste.
Vergleichbar ist das Objekt »Internet« mit einer Plattform,
die Raum für viele nützliche Anwendungen bietet, mit denen der
Nutzer eigentlich arbeitet.
Solche Anwendungen nennt man »Dienste«, manchmal auch »Netzdienste«
oder »Protokolle«. Alle Dienste im Internet haben die Gemeinsamkeit,
dass sie unter dem Internet-Übertragungsprotokoll TCP/IP arbeiten,
sprich: Datenströme in kleine Päckchen stückeln und diese
einzeln vom Absender zum Empfänger schicken, während der Empfänger
den Datenempfang protokolliert und ggf. korrupte Päckchen neu beim
Server anfordert. Dies ist aber auch die einzige, wichtige gemeinsame
Eigenschaft aller Dienste (abgesehen von dem Umstand, dass alle Dienste
dem Zwecke der spezialisierten Datenübertragung dienen). |
|
|
Telnet |
||
| E-Mail (elektronische Post) ist wohl der am meisten genutzte
Internet-Dienst. E-Mail erlaubt die persönliche Übermittlung
von Nachrichten und Dateien von einem Sender an einen Empfänger.
Wer an diesem Dienst teilnehmen will, braucht folglich eine eigene E-Mail-Adresse.
Solche Adressen sind an dem berühmten @ (sprich: englisch "at",
also "bei") in der Mitte erkennbar.
Vor allem im Business-Bereich verdrängt E-Mail nach und nach die herkömmliche Briefpost (von E-Mail-Anhängern liebevoll oder verächtlich als "Schneckenpost" oder "snail mail" bezeichnet). Auch das Fax ist eine durch E-Mail gefährdete Gattung. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Das heutige E-Mail-System hat aber auch noch mit einigen Problemen zu kämpfen. Eine normale E-Mail ist auf dem Weg vom Sender zum Empfänger etwa so geheim wie eine Ansichtskarte. Für vertrauliche Mitteilungen oder sensible Daten ist sie ungeeignet. Mittlerweile gibt es Verschlüsselungsverfahren wie PGP (Pretty Good Privacy), die das individuelle Kodieren und Dekodieren von E-Mails und angehängten Dateien erlauben. Voraussetzung ist dazu jedoch, dass sowohl Sender als auch Empfänger über eine entsprechende Zusatzsoftware verfügen und zuvor ihre öffentlichen Kodierschlüssel austauschen. > E-Mail-Adressen finden Sie hier |
Telnet ist dazu gedacht, einen fernen Rechner im Internet
so zu bedienen, als säße man direkt davor. Telnet ist damit
eine einfache Lösung für Teleworker. Und diese Lösung ist
schon wesentlich älter als der Begriff des "Teleworkings".
Telnet ist vor allem für Unix-Systeme gedacht. Es erlaubt das
betriebssystemeigene login (Anmelden) eines Benutzers an einem ans Internet
angeschlossenen Host-Rechner in Form eines rlogin (remote login). Das
Anmelden ist nur möglich, wenn Sie User-ID und Passwort kennen,
d.h. auf dem angewählten Host-Rechner als Benutzer eingetragen
sind. Nach dem Einwählen erhalten Sie eine Unix-Shell (Eingabeaufforderung)
und können auf dem entfernten Rechner Betriebssystembefehle PC-Anwender, die nicht direkt mit der Verwaltung von Server-Rechnern
im Internet zu tun haben, werden mit Telnet kaum in Berührung kommen.
Es gibt jedoch auch für PC-Benutzer von Systemen wie MS Windows
oder Macintosh Telnet-Clients. Diese Programme erlauben es, vom eigenen
PC aus auf einem entfernten Host-Rechner zu arbeiten. Ohne Kenntnis
der Befehle des Hostrechner-Betriebssystems ist ein solches Programm
allerdings zwecklos.
|
|
File Transfer (FTP) |
Filesharing / Peer-To-Peer |
|
| FTP ist ein Internet-Dienst, der speziell dazu dient, sich
auf einem bestimmten Server-Rechner im Internet einzuwählen und von
dort Dateien auf den eigenen Rechner zu übertragen (Download) oder
eigene Dateien an den Server-Rechner zu übertragen (Upload). Ferner
bietet das FTP-Protokoll Befehle an, um auf dem entfernten Rechner Operationen
durchzuführen wie Verzeichnisinhalte anzeigen, Verzeichnisse wechseln,
Verzeichnisse anlegen oder Dateien löschen.
Beim Einwählen an einem FTP-Server gilt es, zwei Arten zu unterscheiden: es gibt "normales" FTP und anonymes FTP. Beim normalen FTP haben Sie nur Zugriff auf den Server, wenn Sie beim Einwählen eine individuelle User-ID und ein Passwort angeben. Mit diesen Zugangsdaten muss der FTP-Serververwalter Sie am Server als berechtigten Anwender eingetragen haben. Bei anonymem FTP handelt es sich um öffentlich zugängliche Bereiche auf Server-Rechnern. Dazu brauchen Sie keine Zugangsberechtigung. Sie wählen sich einfach mit der User-ID "anonymous" ein, und als Passwort geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Es gibt etliche öffentliche FTP-Server im Internet, die umfangreiche Dateibestände zum Download anbieten. Hier erhalten Sie Software, Hilfetexte, Grafiksammlungen usw. Für öffentliche, anonyme FTP-Server gibt es Regeln. Da Sie beim Besuch solcher Server nur Gast sind, sollten Sie sich auch entsprechend verhalten. Bleiben Sie nicht länger als nötig. Laden Sie sich nicht unnötig viele Dateien herunter. Lesen Sie zuerst die Readme-Dateien, die es in fast jedem Verzeichnis gibt und die den Inhalt des Verzeichnisses erläutern. Wenn Sie lediglich hin und wieder öffentlich zugängliche FTP-Server besuchen, um von dort Dateien downzuloaden, können Sie das auch mit modernen WWW-Browsern wie Netscape oder dem MS Internet Explorer tun. Solche Browser zeigen die Dateilisten auf FTP-Servern als anklickbare Verweise an. Je nach Dateityp können Sie Dateien dann downloaden oder direkt im Browser-Fenster anzeigen. Für anspruchsvollere Arbeiten, vor allem, wenn Sie die Dateien Ihres eigenen WWW-Projekts verwalten wollen, brauchen Sie einen FTP-Programm. Solche Programme gibt es für alle Betriebssysteme, und einige Betriebssysteme, etwa alle Unix-Derivate oder OS/2, haben bereits einen eingebauten FTP-Client. |
Filesharing bezeichnet die gemeinsame Nutzung von Dateien, meist in einem Netzwerk. Dabei können verschiedenen Nutzern von einem Administrator unterschiedliche Berechtigungen eingeräumt werden, etwa lediglich das Aufrufen und Ansehen einer Datei oder aber das Kopieren oder gar Verändern einer Datei. Das Filesharing ist auch Grundlage des P2P (Peer-to-Peer-Netzwerke). In diesen Netzwerken erfolgt der Datenaustausch via Internet, das ohne zentrale Server auskommt. Voraussetzung dazu ist eine Software, die auf der Festplatte des Nutzers ein Verzeichnis einrichtet, auf das andere Nutzer zugreifen dürfen (z.B. Kazaa, Gnutella, eDonkey / eMule). Jeder Nutzer der Software stellt allen anderen Nutzern eine bestimmte Anzahl von Dateien zum Download bereit. Im Gegenzug erhält der Nutzer Zugriff auf alle Dateien, die andere Nutzer zum Datenaustausch freigegeben haben. Prinzipiell können auf diese Weise alle Arten von Dateien getauscht werden - Musiktitel (meist im komprimierten mp3-Format), Kinofilme (als DivX-komprimierte avi-Dateien oder mpg-Dateien), Programme, Bilder, Texte oder Viren. Das Bereitstellen / Tauschen von urheberrechtlich geschütztem Material (z.B. Musikstücken und Kinofilmen) ist allerdings gesetzlich verboten. Die Musik- und Filmindustrie geht daher verstärkt rechtlich gegen Nutzer von P2P-Tauschbörsen vor.
|
|
Gopher |
Chat (Internet Relay Chat = IRC) |
|
| Gopher gilt heute als der Vorläufer des World Wide
Web. Der Name kommt von "go for" und drückt damit aus,
was der wichtigste Zweck dieses Dienstes ist: nämlich große
Informationsbestände leichter durchsuchbar zu machen.
Gopher ist eine menübasierte Bedienoberfläche zum Auffinden von Information, aber auch zum Nutzen anderer Internet-Dienste wie FTP oder Telnet. Einem Eintrag in einem Gopher-Menü ist nicht anzusehen, wo sich die damit verbundenen Dateien oder Programme befinden. Anwender mit text- und tastaturorientierten Rechnern können aus den Menüs, die das Gophersystem am Bildschirm anzeigt, mit Buchstaben- oder Zifferntasten Einträge auswählen. Bei grafischen Benutzeroberflächen sind die Menüs mit der Maus anklickbar. In dieser Hinsicht gleicht Gopher dem World Wide Web, denn auch bei diesem Dienst müssen Sie keine Insider-Befehle kennen, um im Informationsbestand zu navigieren. Der Nachteil von Gopher gegenüber dem WWW ist, dass es keine Standards wie HTML gibt. Es gibt lediglich die Gopher-Menüs und die damit verknüpften Dateiaufrufe oder Befehle. Ein guter Gopher-Client kann zwar diverse Dateiformate anzeigen, doch es gibt kein Mittel, um Bildschirmseiten zu gestalten und dadurch eigenständige Präsentationen von Information zu schaffen. Moderne WWW-Browser wie Netscape sind auch gopherfähig. Das bedeutet, dass Sie mit einem solchen Browser problemlos Gopher-Adressen aufrufen können. Die Gopher-Menüs erscheinen im Browser wie Listen mit Verweisen in HTML. > Aktuelle Gopher-Seiten finden Sie unter http://www1.ku-eichstaett.de/WWF/Suche/Andere/gopher.htm |
Wer sich einsam fühlt oder einfach "in"
sein will, geht im Internet chatten (ratschen, quatschen). Am Bildschirm
erscheint dann ein zweigeteiltes Fenster. In den einen Teil werden wie
von Geisterhand allerlei ganze und halbe Sätze, Kommentare und solche
Dinge wie Emoticons hineingeschrieben. Das sind Beiträge von Teilnehmern,
die gerade an der gleichen Stelle online sind. Im anderen Fenster können
Sie selbst etwas eintippen. Auf diese Weise können Sie an der Unterhaltung
teilnehmen. Mittlerweile gibt es auch grafische Oberflächen, bei
denen sich jeder Chat-Teilnehmer eine Figur aussucht, die dann als Teilnehmer
in einer Szenerie erscheint.
Kaum jemand erscheint dort mit seinem wahren Namen, und nicht wenige geben sich als etwas ganz anderes aus, als sie wirklich sind. Männer spielen Frau, um herauszufinden, wie es ist, als Frau von einem Mann angemacht zu werden. Erwachsene spielen Jugendliche, um sich mal wieder richtig pubertär benehmen zu dürfen. Hin und wieder kommen interessante Gespräche zustande, aber oft haben die Chat-Beiträge auch das Niveau von Kindergestammel. IRC ist einer der Internet-Dienste, die teuer werden können. Denn während der ganzen Teilnahmedauer muss man online sein, und viele merken beim Quatschen nicht, wie die Zeit vergeht (das ist nicht anders als im "real life"). Es gibt nur wenige, die eine ganze Nacht lang im WWW surfen, aber viele, die eine ganze Nacht lang chatten. Viele der hochgradig Internet-Süchtigen treiben sich vor allem in den Chat-Bereichen herum. > interessante Chats finden Sie hier |
|
Usenet (Newsgroups) |
Das World Wide Web (www) |
|
Eine Newsgroup ist einem schwarzes Brett vergleichbar, wo Sie Nachrichten posten können, die alle Besucher lesen können. Jede Newsgroup behandelt einen Themenbereich. Mittlerweile sind mehr als 20.000 Newsgroups im Internet verfügbar. Es gibt praktisch nichts, zu dem es nicht eine Newsgroup gibt. Egal ob Sie sich für die Konfiguration Ihres PCs interessieren, für Origami oder für vermisste Kinder - für alles findet sich eine oder mehrere Newsgroups. Täglich werden zigtausend Nachrichten in Newsgroups gepostet. Es werden Fragen gestellt und Antworten gegeben, es wird debattiert und geflachst. Die Newsgroups gelten allgemein als der verrückteste Teil des Internet. Manchen Leuten sind sie aber auch ein Dorn im Auge, denn es gibt auch etliche Newsgroups mit pornographischen und extremistischen Inhalten. Das System der Newsgroups ist auf verschiedene Netze verteilt. Das größte und bekannteste ist das Usenet. Hier finden Sie Newsgroups mit Adressen wie alt.music.pinkfloyd oder de.soc.weltanschauung. Wichtigsten Abkürzungen in solchen Newsgroup-Adressen sind: • alt = alternativ, bunt, verrückt, abgefahren > Newsgroup-Verzeichnisse finden
Sie hier |
Das World Wide Web ist inzwischen mit Abstand der populärste
Dienst im Internet. Erst mit dem WWW ist es möglich, multimedial
aufgebaute Dokumente im Internet zu präsentieren und mit sogenannten
Hyperlinks aktiv auf andere Ressourcen zu verweisen.
Geschichtliches Im Oktober 1990 wird das World Wide Web (WWW) zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt und im März 1991 netzweit getestet. Zur Nutzung des World Wide Webs wurde ein Browser nötig, der die WWW-Dateien (geschrieben in der Hypertext Markup Language, HTML) liest und entschlüsselt. Der erste, inzwischen legendäre Browser mit dem Namen www ist erstmals 1992 frei im Netz verfügbar. Dann überschlagen sich plötzlich die Ereignisse: Im Jahr 1993 entwickelt das CERN den ersten Browser für die Apple Mac-Plattform, während Marc Andreesen am National Center for Supercomputing Applications (NCSA) an der Universität Illionis den XMosaic-Browser für das UNIX-Betriebssystem schreibt. Diese beiden Browser haben das World Wide Web erst zum Laufen gebracht: Sie boten eine grafische Benutzeroberfläche, die komplett per Mausklick bedient werden konnte. Innerhalb kürzester Zeit vervielfacht sich die Nutzerzahl des World Wide Webs und findige Marktstrategen entdecken das World Wide Web bald als ideale Plattform für Marketing und Werbung. Wer sich für die Entwicklung von Webseiten im Internet interessiert, der sollte bei archive.org vorbeischauen. Dort werden weltweit Pages archiviert. |
|
Technische Standards im Internet |
||
TCP/IP-Protokoll |
IP-Adressierung |
|
| TCP/IP ist der kleinste gemeinsame Nenner des gesamten
Datenverkehrs im Internet. Erst durch dieses Protokoll wurde historisch
gesehen aus einem begrenzten Netz ein Netz der Netze. Egal, ob Sie WWW-Seiten
aufrufen, E-Mails versenden, mit FTP Dateien downloaden oder mit Telnet
auf einem entfernten Rechner arbeiten: stets werden die Daten auf gleiche
Weise adressiert und transportiert. TCP bedeutet Transmission Control
Protocol (Protokoll für Übertragungskontrolle), IP bedeutet
Internet Protocol.
Wenn Sie eine E-Mail verschicken oder eine HTML-Datei im WWW aufrufen, werden die Daten bei der Übertragung im Netz in kleine Pakete zerstückelt. Jedes Paket enthält eine Angabe dazu, an welche Adresse es geschickt werden soll, und das wievielte Paket innerhalb der Sendung es ist. Die Adressierung besorgt das IP. Dazu gibt es ein Adressierungsschema, die sogenannten IP-Adressen. Daß die Datenpakete auch wirklich beim Empfänger ankommen, und zwar in der richtigen Reihenfolge, dafür sorgt das TCP. Das TCP verwendet Sequenznummern für die einzelnen Pakete einer Sendung. Erst wenn alle Pakete einer Sendung vollständig beim Empfänger angekommen sind, gilt die Übertragung der Daten als abgeschlossen. Jeder Rechner, der am Internet teilnimmt, ist mit einer IP-Adresse im Netz angemeldet. Rechner, die ans Internet angeschlossen sind, werden als Hosts oder Hostrechner bezeichnet. Wenn Sie also mit Ihrem PC im WWW surfen oder neue E-Mails abholen, sind Sie mit einer IP-Adresse im Internet angemeldet. Ihr Zugangs-Provider, über dessen Hostrechner Sie sich einwählen, kann feste IP-Adressen für Sie einrichten. Große Zugangs-Provider, etwa Online-Dienste wie CompuServe oder AOL, vergeben auch personenunabhängig dynamische IP-Adressen für jede Internet-Einwahl. Damit ein Rechner am Internet teilnehmen kann, muß er über eine Software verfügen, die das TCP/IP-Protokoll unterstützt. Unter MS Windows ist das beispielsweise die Datei winsock.dll im Windows-Verzeichnis. |
Eine typische IP-Adresse sieht in Dezimalschreibweise so
aus: 149.174.211.5 - vier Zahlen also, getrennt durch Punkte. Die Punkte
haben die Aufgabe, über- und untergeordnete Netze anzusprechen. So
wie zu einer Telefonnummer im weltweiten Telefonnetz eine Landeskennzahl,
eine Ortsnetzkennzahl, eine Teilnehmerrufnummer und manchmal auch noch
eine Durchwahlnummer gehört, gibt es auch im Internet eine Vorwahl
- die Netzwerknummer, und eine Durchwahl - die Hostnummer.
Der erste Teil einer IP-Adresse ist die Netzwerknummer, der zweite Teil die Hostnummer. Wo die Grenze zwischen Netzwerknummer und Hostnummer liegt, bestimmt ein Klassifizierungsschema für Netztypen. Die folgende Tabelle verdeutlicht dieses Schema. In den Spalten für die IP-Adressierung und einem typischen Beispiel ist die Netzwerknummer (der Vorwahlteil) fett dargestellt. Der Rest der IP-Adresse ist die Hostnummer eines Rechners innerhalb dieses Netzes. Netztyp IP-Adressierung Typische IP-Adresse Die oberste Hierarchiestufe bilden die sogenannten Klasse-A-Netze. Nur die erste Zahl einer IP-Adresse ist darin die Netzwerknummer, alle anderen Zahlen sind Hostnummern innerhalb des Netzwerks. Bei Netzwerknummern solcher Netze sind Zahlen zwischen 1 und 126 möglich, d.h. es kann weltweit nur 126 Klasse-A-Netze geben. Eine IP-Adresse, die zu einem Klasse-A-Netz gehört, ist also daran erkennbar, daß die erste Zahl zwischen 1 und 126 liegt. Das amerikanische Militärnetz ist beispielsweise so ein Klasse-A-Netz. Innerhalb eines Klasse-A-Netzes kann der entsprechende Netzbetreiber die zweite, dritte und vierte Zahl der einzelnen IP-Adressen seiner Netzteilnehmer frei vergeben. Da alle drei Zahlen Werte von 0 bis 255 haben können, kann ein Klasse-A-Netzbetreiber also bis zu 16,7 Millionen IP-Adressen an Host-Rechner innerhalb seines Netzes vergeben. Die zweithöchste Hierarchiestufe sind die Klasse-B-Netze. Die Netzwerknummer solcher Netze erstreckt sich über die beiden ersten Zahlen der IP-Adresse. Bei der ersten Zahl können Klasse-B-Netze Werte zwischen 128 und 192 haben. Eine IP-Adresse, die zu einem Klasse-B-Netz gehört, ist also daran erkennbar, daß die erste Zahl zwischen 128 und 192 liegt. Bei der zweiten sind Zahl Werte zwischen 0 und 255 erlaubt. Dadurch sind etwa 16.000 solcher Netze möglich. Da die Zahlen drei und vier in solchen Netzen ebenfalls Werte zwischen 0 und 255 haben dürfen, können an jedem Klasse-B-Netz bis zu ca. 65.000 Hostrechner angeschlossen werden. Klasse-B-Netze werden vor allem an große Firmen, Universitäten und Online-Dienste vergeben. Die unterste Hierarchie stellen die Klasse-C-Netze dar. Die erste Zahl einer IP-Adresse eines Klasse-C-Netzes liegt zwischen 192 und 223. Die Zahlen zwei und drei gehören ebenfalls noch zur Netzwerknummer. Über zwei Millionen solcher Netze sind dadurch adressierbar. Vor allem an kleine und mittlere Unternehmen mit direkter Internet-Verbindung, auch an kleinere Internet-Provider, werden solche Adressen vergeben. Da nur noch eine Zahl mit Werten zwischen 0 und 255 übrig bleibt, können in einem C-Netz maximal 255 Host-Rechner angeschlossen werden. Ob dieses Adressierungs-Schema den Anforderungen der Zukunft noch
gerecht wird, bezweifeln manche. Es gibt bereits Ideen zu einer Neustrukturierung
der Adressierung von Netzen und Hostrechnern. |
|
Client-Server-Technologie |
||
Für die einzelnen Internet-Dienste wie World Wide
Web, Gopher, E-Mail, FTP usw. muß auf einem Hostrechner, der anderen
Rechnern diese Dienste anbieten will, eine entsprechende Server-Software
laufen. Ein Hostrechner kann einen Internet-Dienst nur anbieten, wenn
eine entsprechende Server-Software auf dem Rechner aktiv ist, und wenn
der Rechner "online" ist.
|
Wenn Sie etwa auf einen Verweis klicken, der zu einer HTTP-Adresse
führt, startet der Browser, also der WWW-Client, eine Anfrage an
den entsprechenden Server auf dem entfernten Hostrechner. Der Server wertet
die Anfrage aus und sendet die gewünschten Daten. Um die Kommunikation
zwischen Clients und Servern zu regeln, gibt es entsprechende Protokolle.
Client-Server-Kommunikation im WWW etwa regelt das HTTP-Protokoll. Ein
solches Protokoll läuft oberhalb des TCP/IP-Protokolls ab. Daß ein Client Daten anfordert und ein Server die Daten sendet, ist der Normalfall. Es gibt jedoch auch "Ausnahmen". So kann ein Client nicht nur Daten anfordern, sondern auch Daten an einen Server schicken: zum Beispiel, wenn Sie per FTP eine Datei auf den Server-Rechner hochladen, wenn Sie eine E-Mail versenden oder im WWW ein Formular ausfüllen und abschicken. Bei diesen Fällen redet man auch von Client-Push ("Client drängt dem Server Daten auf"). Ein anderer Ausnahmefall ist es, wenn der Server zuerst aktiv wird und dem Client etwas ohne dessen Anforderung zuschickt. Das nennt man Server-Push ("Server drängt dem Client Daten auf"). Neue Technologien wollen diesen Ausnahmefall zu einer Regel erheben: die sogenannten Push-Technologien. Diese Technologien sollen ermöglichen, daß ein Client regelmäßig Daten empfangen kann, ohne diese eigens anzufordern. Dadurch sind Broadcasting-Dienste wie aktuelle Nachrichten usw. realisierbar. Netscape und Microsoft Internet Explorer (beide ab Version 4.0) haben entsprechende Schnittstellen, um solche Dienste in Anspruch zu nehmen. |
|
DNS - Domain Name Service |
||
| Computer können mit Zahlen besser umgehen, Menschen
in der Regel besser mit Namen. Deshalb hat man ein System ersonnen, das
die numerischen IP-Adressen für die Endanwender in anschauliche
Namensadressen übersetzt.
Dazu hat man ein System geschaffen, das ähnlich wie bei den IP-Adressen hierarchisch aufgebaut ist. Eine Namensadresse in diesem System gehört zu einer Top-Level-Domain und innerhalb dieser zu einer Sub-Level-Domain. Jede Sub-Level-Domain kann nochmals untergeordnete Domains enthalten, muß es aber nicht. Die einzelnen Teile solcher Namensadressen sind wie bei IP-Adressen durch Punkte voneinander getrennt. Eine solche Namensadresse ist beispielsweise teamone.de. Top-Level-Domains stehen in einem Domain-Namen an letzter Stelle. Es handelt sich um einigermaßen sprechende Abkürzungen. Die Abkürzungen, die solche Top-Level-Domains bezeichnen, sind entweder Landeskennungen oder Typenkennungen. Jede dieser Top-Level-Domains stellt einen Verwaltungsbereich dar,
für die es auch eine "Verwaltungsbehörde" gibt,
die für die Namensvergabe von Sub-Level-Domains innerhalb ihres
Verwaltungsbereichs zuständig ist. Wenn Sie beispielsweise einen
Domain-Namen wie MeineFirma.de beantragen wollen, muß der Antrag
an das DENIC (Deutsches Network Information Center) gestellt werden.
Kommerzielle Provider erledigen das für Sie, wenn Sie dort einen
entsprechenden Service in Anspruch nehmen. Inhaber von zweiteiligen Domain-Namen können nochmals Sub-Level-Domains vergeben. So gibt es beispielsweise eine Domain namens seite.net. Die Betreiber dieser Domain haben nochmals Sub-Domains vergeben, wodurch Domain-Adressen wie java.seite.net oder javascript.seite.net entstanden. |
Derzeit verwendete Typenkennungen: com = Kommerziell orientierter Namensinhaber org = Organisation Häufig anzutreffende Länderkennungen: > alle Länderkennungen finden Sie bei Rainer Werle Die Rechte an einigen Länderkennungen wurden allerdings meistbietend
weiterverkauft: |
|
Routing und Gateways |
||
| Im Internet als dem Netz der Netze ist es zunächst
nur innerhalb des eigenen Sub-Netzes möglich, Daten direkt von einer
IP-Adresse zu einer anderen zu schicken. In allen anderen Fällen,
wenn die Daten an eine andere Netzwerknummer geschickt werden sollen,
treten Rechner auf den Plan, die den Verkehr zwischen den Netzen regeln.
Solche Rechner werden als Gateways bezeichnet. Diese Rechner leiten Daten
von Hostrechnern aus dem eigenen Sub-Netz an Gateways in anderen Sub-Netzen
weiter und ankommende Daten von Gateways anderer Sub-Netze an die darin
adressierten Host-Rechner im eigenen Sub-Netz. Ohne Gateways gäbe
es gar kein Internet.
Das Weiterleiten der Daten zwischen Sub-Netzen wird als Routing bezeichnet. Die Beschreibung der möglichen Routen vom eigenen Netzwerk zu anderen Netzwerken sind in Routing-Tabellen auf den Gateway-Rechnern festgehalten. Zu den Aufgaben eines Gateways gehört auch, eine Alternativ-Route zu finden, wenn die übliche Route nicht funktioniert, etwa, weil bei der entsprechenden Leitung eine Störung oder ein Datenstau aufgetreten ist. Gateways senden sich ständig Testpakete zu, um das Funktionieren der Verbindung zu testen und für Datentransfers "verkehrsarme" Wege zu finden. Wenn also im Internet ein Datentransfer stattfindet, ist keinesfalls
von vorneherein klar, welchen Weg die Daten nehmen. Sogar einzelne Pakete
einer einzigen Sendung können völlig unterschiedliche Wege
nehmen. Wenn Sie beispielsweise von Deutschland aus eine WWW-Seite aufrufen,
die auf einem Rechner in den USA liegt, kann es sein, daß die
Hälfte der Seite über den Atlantik kommt und die andere über
den Pazifik, bevor Ihr WWW-Browser sie anzeigen kann. Weder Sie noch
Ihr Browser bekommen davon etwas mit. |
Außerdem gibt es Gateways, die eine Kommunikation
zwischen unterschiedlichen Datennetzen oder Datei-Diensten des Internets
ermöglichen. Hier ein paar Beispiele für www-Gateways: • Newsgroups: • w100w Usenet Gateway • Google Groups • Chat: Webchat.de • FTP: Techie-Buzz • Gopher: Gopher-Suche • Z39.50-Datenbanken: GBV |
|
Wofür HTML? |
||
| Elemente auszeichnen HTML bedeutet HyperText Markup Language. Es handelt sich dabei um eine Sprache, die mit Hilfe von SGML (Standard Generalized Markup Language) definiert wird. SGML ist als ISO-Norm 8879 festgeschrieben. HTML ist eine sogenannte Auszeichnungssprache (Markup Language). Sie hat die Aufgabe, die logischen Bestandteile eines Dokuments beschreiben. Als Auszeichnungssprache enthält HTML daher Befehle zum Markieren typischer Elemente eines Dokuments, wie Textabsätze, Listen, Tabellen oder Grafikreferenzen. Das Beschreibungsschema von HTML geht von einer hierarchischen Gliederung aus. HTML beschreibt Dokumente. Dokumente haben globale Eigenschaften wie zum Beispiel einen Titel oder eine Hintergrundfarbe. Der eigentliche Inhalt besteht aus Elementen, zum Beispiel einer Überschrift 1. Ordnung. Einige dieser Elemente haben wiederum Unterelemente. So enthält ein Textabsatz zum Beispiel eine als fett markierte Textstelle, eine Aufzählungsliste besteht aus einzelnen Listenpunkten, und eine Tabelle gliedert sich in einzelne Tabellenzellen. Die meisten dieser Elemente haben einen fest definierbaren Erstreckungsraum.
So geht eine Überschrift vom ersten bis zum letzten Zeichen, eine
Aufzählungsliste vom ersten bis zum letzten Listenpunkt, oder
eine Tabelle von der ersten bis zur letzten Zelle. Auszeichnungen markieren
Anfang und Ende von Elementen. Um etwa eine Überschrift auszuzeichnen,
lautet das Schema: Bei einem Element, das wiederum Unterelemente besitzt, etwa einer Aufzählungsliste,
läßt sich das gleiche Schema anwenden: WWW-Browser, die HTML-Dateien am Bildschirm anzeigen, lösen die
Auszeichnungsbefehle auf und stellen die Elemente dann in optisch gut
erkennbarer Form am Bildschirm dar. Dabei ist die Bildschirmdarstellung
aber nicht die einzige denkbare Ausgabeform. HTML kann beispielsweise
genauso gut mit Hilfe synthetisch erzeugter Stimmen auf Audio-Systemen
ausgegeben werden. |
Vernetzung herstellen Eine der wichtigsten Eigenschaften von HTML ist die Möglichkeit, Verweise zu definieren. Verweise ("Hyperlinks") können zu anderen Stellen im eigenen Projekt führen, aber auch zu beliebigen anderen Adressen im World Wide Web und sogar zu Internet-Adressen, die nicht Teil des WWW sind. Durch diese einfache Grundeigenschaft eröffnet HTML völlig neue Welten. Das Bewegen zwischen räumlich weit entfernten Rechnern wird bei modernen grafischen WWW-Browsern auf einen Mausklick reduziert. In Ihren eigenen HTML-Dateien können Sie Verweise notieren und dadurch inhaltliche Verknüpfungen zwischen Ihren eigenen Inhalten und denen anderer Anbieter herstellen. Auf dieser Grundidee beruht letztlich das gesamte World Wide Web, und dieser Grundidee verdankt es seinen Namen. Im Zeitalter der Kommerzialisierung des Internet sind natürlich
auch die Verweise zu einem kommerziellen Gegenstand geworden. Anklickbare
Werbe-Grafiken ("Banner") auf häufig besuchten Seiten
führen zu Anbietern, die für die Plazierung der Banner Miete
bezahlen. Auch das sind Verweise. Glücklicherweise gibt es daneben
aber weiterhin genügend "herkömmliche" Verweise
im WWW, die einfach nur die Grundidee des Web verfolgen und zur weltweiten
Vernetzung von Information beitragen wollen. |
|
Softwareunabhängiger Klartext Die Klartext-Befehle von HTML sind für Maschinen und Menschen gedacht. Wer keine sinnlosen Vorurteile gegenüber sichtbaren Befehlen am Bildschirm hat, wird in HTML eine überraschend einfache Befehlssprache finden. Die Sprache ist Englisch, doch da die Anzahl der Befehle begrenzt ist, ist es auch ohne tiefere Kenntnisse der englischen Sprache möglich, sich in HTML hineinzudenken. Da HTML ein Klartextformat ist, läßt es sich auch hervorragend mit Hilfe von Programmen generieren. Von dieser Möglichkeit machen beispielsweise CGI-Programme Gebrauch. Wenn Sie im WWW zum Beispiel einen Suchdienst benutzen und nach einer Suchanfrage die Ergebnisse präsentiert bekommen, dann ist das, was Sie am Bildschirm sehen, HTML-Code, der von einem Programm generiert wurde. |
Universelle Einsetzbarkeit > alles zum Thema HTML und allen verwandten Internetsprachen finden Sie hier |
|
Suchstrategien |
||
Man findet im Internet Informationen zu fast allem und zu jedem Thema - incl. vieler "Halbwahrheiten" und "Enten". Für fundierte Informationen bürgen letztlich nur glaubwürdige Quellen. In dem Wust von Informationen, die gleichwertig nebeneinander her existieren,
ist es schwer den Überblick zu bewahren. |
Beim Surfen durch das World Wide Web kann man auf verschiedene Weise vorgehen: |
|
URL eingeben |
Web-Kataloge |
|
Die am meisten verbreitete Variante durch das www zu surfen ist es, direkt im Browser (Internet Explorer / Netscape / Mozilla / Opera / T-Online-Browser / AOL-Browser) eine bekannte oder vermutete Internetadresse einzugeben. Dies ist vor allem erfolgversprechend, wenn man das Angebot einer großen
Firma sucht. So findet man BMW unter www.bmw.de, das Nachrichtenmagazin
Spiegel unter www.spiegel.de usw. Links folgenWenn man auf einer Seite gelandet ist, die dem gesuchten Interseensgebiet entspricht, ist es häufig erfolgversprechend, den Links auf der Seite zu folgen. Es gehört zum guten Ton, auf andere Webseiten hinzuweisen, die weitergehende Informationen bereitstellen. Texte auf Webseiten werden mittels "Hyperlinks" miteinander verknüpft - es entstehen "Hypertexte". Dieses Prinzip ist die Grundlage des World Wide Web. Beispiele: |
Wer Seiten zu einem Themenfeld sucht oder keine passenden Suchbegriffe kennt, sollte Kataloge nutzen. Hier werden Webseiten Kategorien und Subkategorien zugeordnet. Der User hangelt sich auf der Suche nach einer bestimmten Seite durch die Kategorienstruktur. Bei den Zuordnungen handelt es sich oft um handverlesene Einträge, die meist redaktionell betreut werden. Die Redakteure werden entweder dafür bezahlt (z.B. Yahoo) oder rekrutieren sich aus der Netzgemeinschaft (z.B. DMOZ). Vorteil: Nachteil: geeignet für: Beispiele: |
|
Suchmaschinen / Suchmasken |
Meta-Suchmaschinen |
|
Die Suche nach einer bestimmten Seite erfolgt anhand eingegebener "Keywords". Alle Seiten, in denen der Begriff im Titel oder in den Meta-Tags, nachrangig z.T. auch im Fließtext vorkommt, werden dem User angezeigt. Wer Seiten zu einem bestimmten Begriff recherchieren will, sollte Suchmasken nutzen. Vorteile: Nachteil: geeignet für: |
Wer zu sehr speziellen Begriffen Informationen sucht, der kann mehrere Suchmaschinen gleichzeitig für sich arbeiten lassen. Doubletten können so herausgefiltert werden. Auch eine komfortable erweiterte Suche ist in der Regel möglich. Vorteil: Nachteile: geeignet für: Beispiele, national: Beispiele, international: |
|
Auflistung der Treffer |
Suchoptionen bei Suchmaschinen |
|
| Suchmaschinen zeigen alle Dokumente an, in denen der
eingegebene Suchbegriff auftaucht. Wenn (möglichst viele) der folgenden
Kriterien auf ein Dokument zutreffen, so wird diesem von der Suchmaschine
hohe Relevanz zugestanden:
|
In (fast) allen Suchmaschinen ist eine erweiterte
Suche mittels der Bool'schen
Operatoren möglich.
Wenn man mehrer Wörter gruppieren möchte, dann muss man bei den meisten Suchmaschinen (z.B. Google, Alta Vista, Yahoo und Lycos) diese in Anführungszeichen setzen (z.B. "Romeo und Julia"), andere gruppieren sie automatisch (Excite). Außerdem läßt sich die Suche bei allen Suchmaschinen
(z.T. auch nachträglich) auf Themenbereiche, Regionen oder Sprachräume
eingrenzen. |
|
Spezialisierte Suchmaschinen / Portalseiten |
Webrings & Blogs |
|
Wenn Sie Seiten aus klar abgrenzbaren Themenbereichen suchen, dann sollten Sie Spezialisten bemühen. Solche Bereiche können Seiten für Kinder, christliche Webseiten, branchenspezifische Seiten oder Seiten zu bestimmten Wissenschaftsgebieten sein. Es gibt zahlreiche Kataloge und Portalseiten, die sich bemühen, die Websites eines Themenbereichs zu erfassen. Meist werden auch themenspezifische News und andere Mehrwertdienste mit angeboten, die Sie vermutlich interessieren werden. Vorteile: Nachteile: geeignet für: > spezialisierte Suchverzeichnisse finden Sie hier
|
Wenn Sie Seiten aus klar abgrenzbaren Themenbereichen suchen,
könne Sie auch auf Webrings zurückgreifen. Hier haben sich Seiten
mit ähnlichem Inhalt zusammengefunden und sich gegenseitig verlinkt.
Webrings gibt es zu unterschiedlichsten Themenbereichen. Sie finden diese
gezielt durch spezialisierte Suchkataloge. Vorteil: Nachteile: geeignet für: |
|
Expertenwissen: Usenet |
Expertenwissen: Netz-Communities |
|
Im Usenet findet der fachliche Austausch unter Experten statt. Sie können sich als interessierter Fachmann in die Diskussion einklinken. In den hoch spezialisierten Newsgroups finden Sie mit Sicherheit Antworten auf fast alle Fragen - vom Hobby bis zum Beruf. In Newsgroups muss man sich allerdings eintragen, ggf. von einem Diskussionsleiter zugelassen werden - und man sollte dann auch über einen längeren Zeitraum die Diskussion verfolgen und aktiv an dieser teilnehmen. Vorteile: Nachteile: geeignet für: > Newsgroup-Verzeichnisse finden
Sie hier |
Wenn Sie kurzfristig Antworten auf spezielle Fragen erhalten möchten, dann macht es Sinn, einen Experten zu konsultieren. Im Internet gibt es Gemeinschaften, in denen Sie sich in der Regel erst als Experte für bestimmte Themen registrieren müssen. Diese Themen können berufsspezifisch sein, sich aber auch um Hobbies drehen. Nach der Registrierung haben Sie dann Zugriff auf das geballte Expertenwissen der mittlerweile recht großen Communities. Vorteil: Nachteil: geeignet für: > Weitere Experten-Communities finden Sie hier
|
|
Internet-Begrifflichkeit (Glossare) |
Weiterführende Internet- Recherche-Quellen |
|
Um tiefer in die Materie "Internet" einzusteigen, habe ich ein paar sehr empfehlenswerte Einf�hrungen in das Internet - seine Geschichte, seinen Aufbau, seine Vor- & Nachteile - zusammengetragen:
|
Wenn Sie tiefer in die Materie der Suchmaschinen,
Ihre Herkunft und ihre Ordnungssysteme einsteigen möchten, empfehle
ich folgende weiterführende Literatur:
Die neuesten Internet-Nutzungs-Daten und weitere aktuelle Studien: |
|